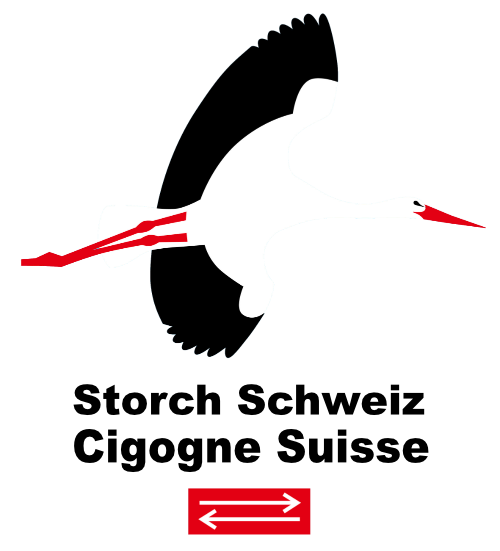Storchenzug im Wandel
Unser Projekt in Spanien: Forschung für den Storchenzug
Das Zugverhalten der westziehenden Weissstörche (Ciconia ciconia) hat sich geändert: Ein großer Teil dieser Vögel zieht nicht mehr, wie üblich, zum Überwintern nach Westafrika, sondern überwintert im Süden Spaniens. Als „Storch Schweiz“, die schweizerische Gesellschaft für den Schutz des Weissstorchs, in den Jahren 2000 und 2001 ihr grosses Satellitentelemetrie-Projekt „SOS Storch“ durchführte, fand man heraus, dass bereits fast die Hälfte der schweizerischen Störche in Südspanien „hängen bleibt“. Dies hat sich bis heute nicht geändert. Viele Tausend „Westzieher“ beenden den Zug nach Süden in Spanien, finden Nahrung in Reisfeldern und vor allem auf grossen, offenen Mülldeponien.
Pressemitteilung Projekt "SOS Storch - Storchenzug im Wandel"
(Belegexemplar bitte an Storch Schweiz, Sekretariat, Bergstrasse 46, 8280 Kreuzlingen)
Pressetexte:
Die zum Download bereitgestellte, gezippte Datei enthält die folgenden Word-Dokumente:
Hintergrundinformationen und Fakten:
Der Text darf nur im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung über das Projekt vollständig oder in Auszügen honorarfrei verwendet werden.
Reportage:
Der Text darf nur im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung über das Projekt honorarfrei verwendet werden. Bei Abdruck der gesamten Reportage ist Dr. Holger Schulz/Storch Schweiz als Autor zu nennen, bei auszugsweiser Verwendung Zitierung der Auszüge (Dr. Holger Schulz/Storch Schweiz).
Mit dem Download der Texte erklären Sie sich mit den oben genannten Nutzungsbedingungen einverstanden.
Download der Pressetexte
Pressefotos
Klicken sie auf ein Foto, um die Galerie zu starten.
SOS Storch 2001 Berichte und Ergebnisse
Das Projekt SOS-Storch
In einer in dieser Grössenordnung bisher nicht dagewesenen Aktion, unter Einsatz modernster Technologien, und mit grossem fachlichen Input begleitete "Storch Schweiz" - in den Jahren 2000-2001 in Zusammenarbeit mit dem Naturhistorischen Museum der Burgergemeinde Bern und unterstützt von zahlreichen Sponsoren die Störche auf ihren Zugwegen zwischen der Schweiz und Westafrika.
Die Feldforschungsarbeiten sind jetzt abgeschlossen, die Daten wurden ausgewertet und in einem Forschungsbericht von Dr. Holger Schulz veröffentlicht.
Sie können die Berichte jeweils als pdf-Datei herunterladen:
Ökologie des Weissstorchs in Westafrika
Zugbewegungen
Zugrouten und Zugverhalten
Verluste
Rastplätze
Die im Projekt "SOS Storch" mitarbeitenden Naturschützer und Wissenschaftler ermittelten die Faktoren, die massgeblich zur Gefährdung der Art beitragen.
Was genau sind die drohendsten Verlustursachen?
Wo konzentrieren sich gefährliche Freileitungen?
Wo fallen die Vögel Jägern zum Opfer?
An welchen Stellen fehlt es an geeigneten Nahrungsflächen?
"Satellitentelemetrie" heisst das Zauberwort für den Erfolg des Projekts. Kleine Sender, nicht mehr als 40-50 Gramm schwer, werden den Störchen noch am Brutort auf den Rücken gebunden. Während der Wanderung nach Afrika zeigen sie den Forschern von "SOS Storch" kontinuierlich an, wo gerade sich die besenderten Störche aufhalten.