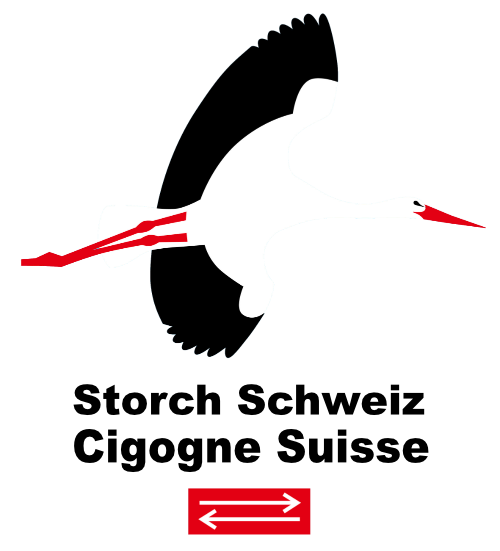Die Gesellschaft Storch Schweiz
Ziel der Gesellschaft ist die Erhaltung und Förderung des wildlebenden Weissstorchbestands in der Schweiz und der Schutz geeignerter Lebensräume. Die Schutzmassnahmen für den Weissstorch erfordern eine nationale und internationale Koordination der Natur- und Artenschutzprojekte. Unsere Aufgabe sehen wir unter anderem in der Aufklärung der Bevölkerung, der Datenerhebung über den Weissstorch, der Dokumentation von Gefahren für den Storch, der Öffentlichkeitsarbeit und der Erstellung und Sicherung von Nistplätzen. Um das Weiterbestehen des Weissstorches zu sichern, hat die Gesellschaft Storch Schweiz einen nationalen "Aktionsplan für den Weissstorch" erarbeitet.
Vorstand der Gesellschaft Storch Schweiz
Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung gewählt.
Zur Zeit besteht der Vorstand aus folgenden Personen.
| Name | Funktion | Kontakt |
|---|---|---|
| Tobias Salathé | Präsident | tobias.salathe(at)outlook.com |
| Olivier Biber | Vizepräsident | o.biber(at)bluewin.ch |
| Peter Enggist | Geschäftsführer, Nachfolger von Max Bloesch | storch-schweiz@bluewin.ch |
| Margrith Enggist | Geschäftsstelle und Kassierin, Regionsleiterin Zentralschweiz | Bergstrasse 46, 8280 Kreuzlingen, Telefon 062 965 29 26, storch-schweiz(at)bluewin.ch |
| Anja Marty | Aktuarin und Vertretung Schweiz. Vogelwarte | anja.marty(at)vogelwarte.ch |
| Bruno Gardelli | Weissstorch Monitoring Nordwestschweiz | N 079 653 48 87, bruno.gardelli(at)intergga.ch |
| Sabine A. Fuchs | Weissstorch Monitoring Murimoos | N 076 489 76 88, mail(at)be-fox.de |
| Thomas Leimer | Vertreter Verein Für üsi Witi | thomas.leimer(at)bluewin.ch |
| Hans Däpp | Beisitzer | h.daepp(at)hotmail.com |
| Viktor Stüdeli | Beisitzer | v.stuedeli(at)besonet.ch |
| Lotte Schäfer-Bloesch | Beisitzerin, Tochter des Storchenvaters "Max Bloesch, sel." | keine Angaben |
| Reto Schlegel | Revisor | |
| Thomas Rellstab | Revisor |
Geschichte des Storchenschutzes in der Schweiz
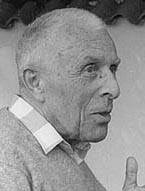
Um 1900 waren im schweizerischen Mittelland rund 140 Nester bekannt, in denen regelmässig gebrütet wurde. Bis 1949 ging der Bestand auf ein einziges Paar zurück und 1950 blieb auch dieser letzte Horst verwaist.
Gründe für den dramatischen Bestandesrückgang gab es viele, in erster Linie war die Witterung, Nässe und Kälte im Frühling mitverantwortlich, zudem wurden immer mehr Flüsse und Bäche verbaut, Feuchtgebiete trockengelegt und die Mechanisierung der Landwirtschaft schuf eine immer eintönigere Landschaft. Auch starben viele Störche auf ihrem Zug in den Süden.
1948 gründete Max Bloesch die Storchensiedlung Altreu. Jungstörche, anfänglich aus Europa, später aus Nordafrika, wurden über die kritischen Jugendjahre im Gehege behalten und nach Erlangung der Brutreife und Paarbildung freigelassen. Diese Vögel verbleiben auch heute noch im Winter bei uns.
In den 1960er Jahren beginnen sich erste Erfolge einzustellen. Die Vögel brüten erfolgeich und vermehre sich. Das Pionierprojekt macht Schule. 1965 wurde in Uznach die erste Aussenstation gegründet. Während der nächsten Jahre entstehen in der Schweiz 24 Aufzuchtstationen zwischen Denens am Genfersee und Kriessern im St. Galler Rheintal.
Unter dem Patronat der Schweizerischen Vogelwarte wurde 1976 die "Gesellschaft zur Förderung des Storchenansiedlungsvesuches" gegründet. 1993 erhielt sie den neuen Namen "Schweizerische Gesellschaft für den Weissstorch, Altreu", und 2002 gab die Mitgliederversammlung der Gesellschaft den Namen "Storch Schweiz".
Am 03. März 1990 erlitt Dr. Max Bloesch im 82, Lebensjahr einen schweren Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr richtig erholte. Auf seinen Wunsch und im Einverständnis des Vorstandes übergab er die Leitung an Peter Enggist, dem heutigen Geschäftsführer.
Am 09. August 1997 stirbt Max Bloesch im Alter von 89 Jahren.
Umorientierung im Weissstorchschutz
Die Wiedereinbürgerung des 1950 in der Schweiz ausgestorbenen Weissstorchs ist ein Erfolg. Dank der erfolgreichen Massnahmen stehen nicht mehr Zucht und Auswilderung im Mittelpunkt. Vielmehr soll der Lebensraum des Storches erhalten und verbessert werden. Heute leben hierzulande über 900 Brutpaare, deutlich mehr als Anfangs des 20. Jahrhunderts. An einer internationalen Tagung 1995 in Russheim bei Karlsruhe (D) beschliessen die Storchenexperten deshalb mit der Zucht und Haltung aufzuhören und sich auf die Etablierung einer sich selbst erhaltenden Population von freifliegenden Wildvögeln zu konzentrieren.
Die Rettung des Weissstorchs kann nur gelingen, wenn auf eine Zufütterung verzichtet werden kann und der Zug in die Winterquartiere eine Reise mit Rückkehr wird. Auch die Internationale Zusammenarbeit wurde im Storchenschutz immer wichtiger.
Um das Weiterbestehen des wunderbaren Stelzvogels zu sichern, hat die Gesellschaft Storch Schweiz einen nationalen "Aktionsplan für den Weissstorch" erarbeitet. Er wurde vom Bundesamt für Umwelt in Absprache mit den Kantonen für den Naturschutz verteilt. Sie können sich dieses Dokument als pdf-Datei herunterladen oder als html Datei anschauen und ausdrucken.
Statuten
Sie können hier die Statuten der Gesellschaft Storch Schweiz als PDF-Datei herunterladen:
Statuten-Storch-Schweiz.pdf